560 Seiten Grundlagenbericht, 90 Seiten Strategiebericht, 94 Seiten Massnahmenbericht: Wer sich näher mit der Biodiversitätsstrategie des Kantons Graubünden auseinandersetzt, kommt unweigerlich ins Staunen ob des gewaltigen Papierbergs. Wurde hier mit grossem Aufwand nur ein Papiertiger geschaffen? Oder, um im gleichen Bild zu bleiben: Hat der Berg eine Maus geboren?
Nein. Die Biodiversitätsstrategie ist keine akademische Fingerübung, sondern eine dringend nötige Investition ins Naturkapital. Und dieses bildet – gerade für einen Tourismuskanton wie jenen von Graubünden – die wirtschaftliche und ökologische Überlebensgrundlage. Mehr noch: Es geht letztlich um nicht weniger als die Sicherung unserer natürlichen Lebensgrundlagen für kommende Generationen.
Die Strategie überzeugt vor allem in drei Punkten. Erstens setzt sie auf Eigenverantwortung und Kooperation statt auf Zwang. Es werden weder neue Verbote erlassen noch bestehende Programme torpediert. Im Gegenteil: Bestehende Initiativen werden vernetzt und dort ergänzt, wo es nötig ist.
Zweitens ist der Nutzen der Biodiversität für Wirtschaft und Gesellschaft weithin unbestritten. Sauberes Wasser, gesunde Wälder, stabile Böden – auf diesen Fundamenten steht gerade in Bergregionen das ganze Wirtschafts- und Lebensmodell.
Drittens liegt ein fundierter Bericht vor, der das Wissen zahlreicher Fachleute bündelt. Daraus resultieren 28 Massnahmen mit klaren Verantwortlichkeiten und verbindlichem Monitoring.
Und doch: Papier bleibt geduldig. Gerade beim Umweltschutz zeigt sich das immer wieder. Die Gewässerschutzgesetzgebung etwa sieht seit 2011 verbindliche Vorgaben zur Aufwertung der Gewässerlebensräume vor. Doch es hapert am Vollzug. Auch in Graubünden, wo Projekte zur Sanierung der Wasserkraft – Stichwort Schwall-Sunk-Problematik oder das Ausscheiden von Gewässerräumen – bislang auf sich warten lassen. Dabei hält der Grundlagenbericht klar fest: Bei den wassergebundenen Lebensräumen sind die grössten Defizite zu finden.
Die Biodiversitätsstrategie von Graubünden ist der richtige Weg. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die verschiedenen Akteure ins Boot zu holen. Dass dazu noch Überzeugungsarbeit nötig ist, haben die kritischen Stellungnahmen im Mitwirkungsverfahren deutlich gemacht.
Autor: Reto Stifel
Foto: Monika Baumüller
Autor: Reto Stifel
Foto: Monika Baumüller
r.stifel@engadinerpost.ch



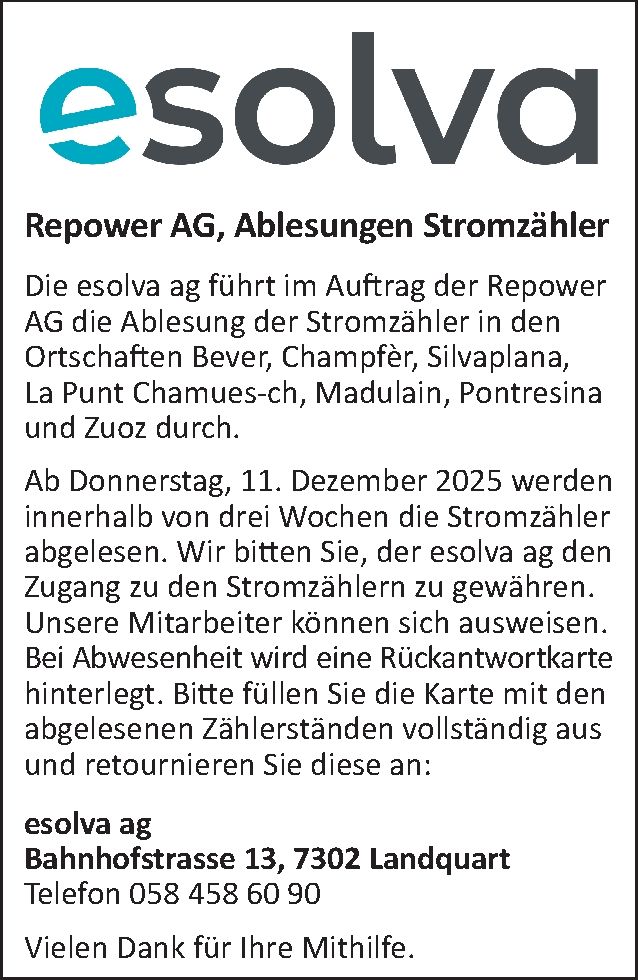
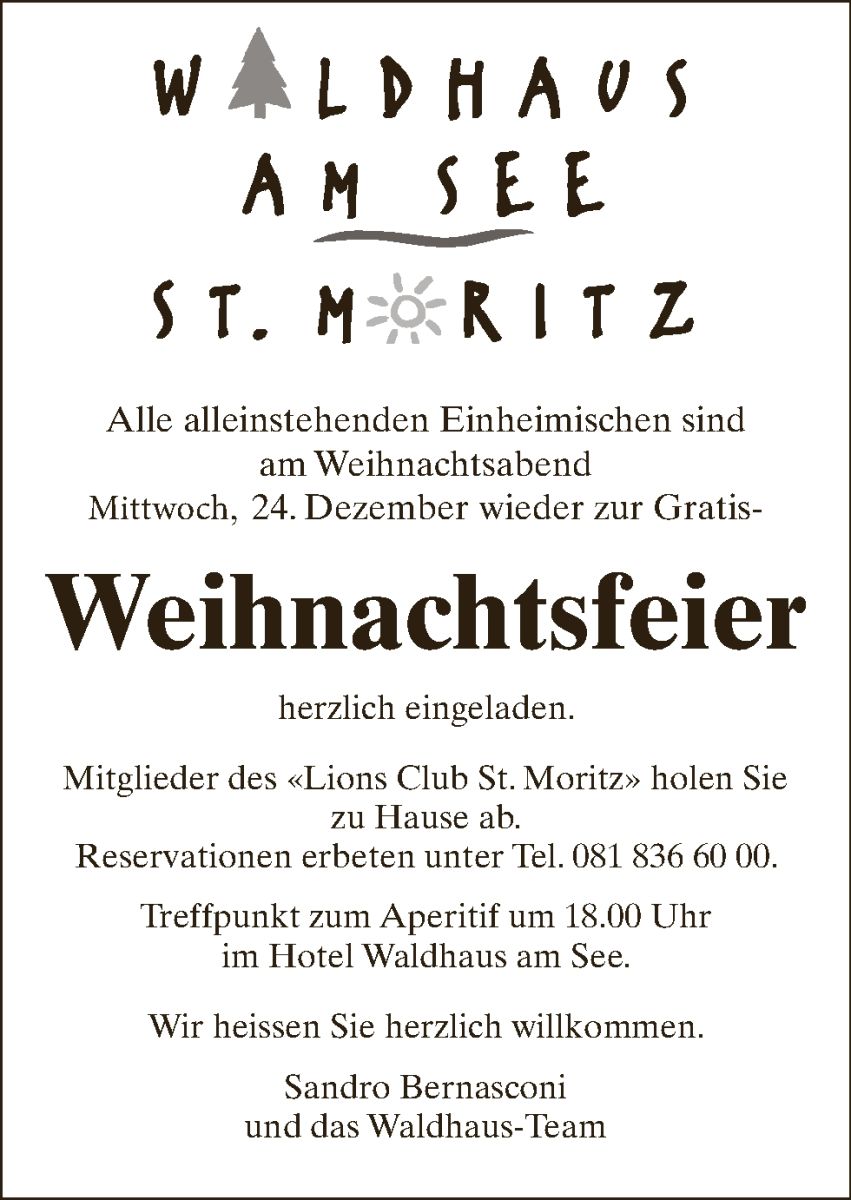


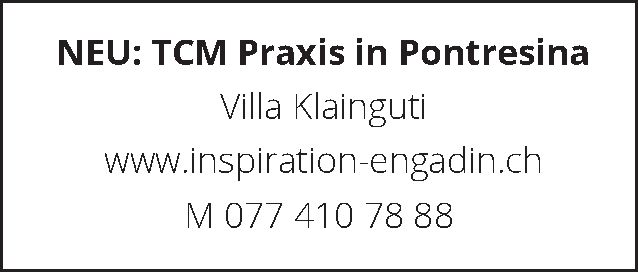
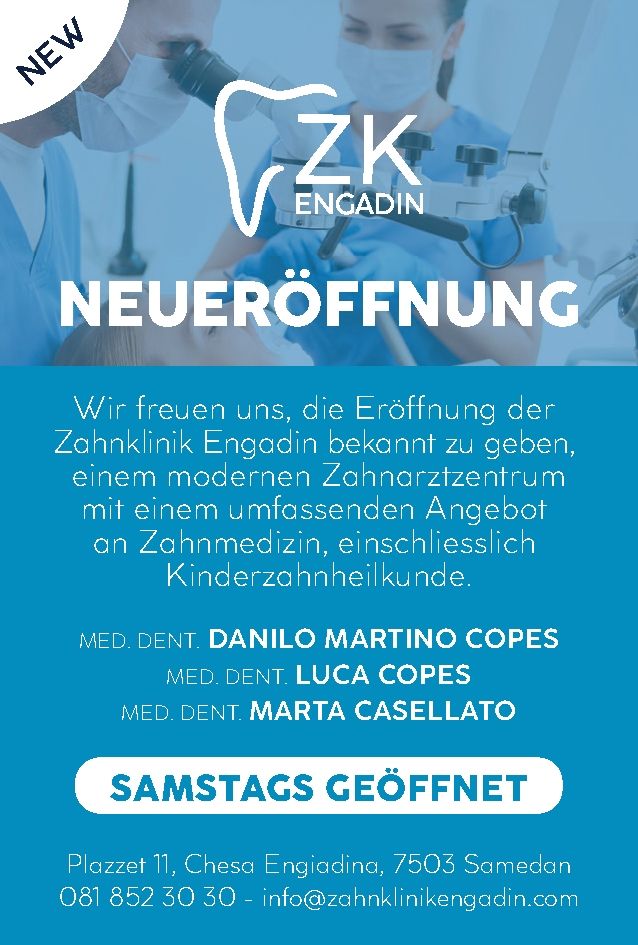



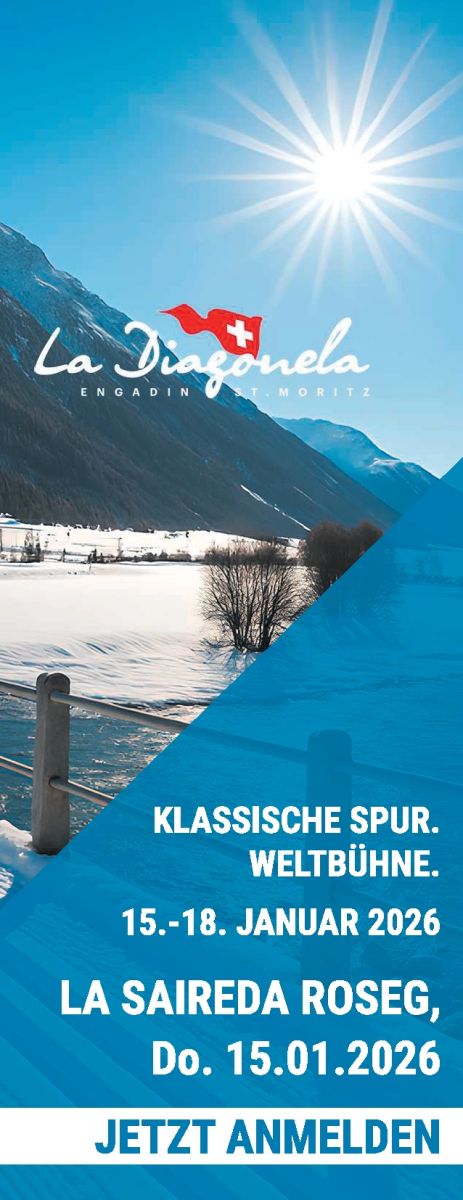

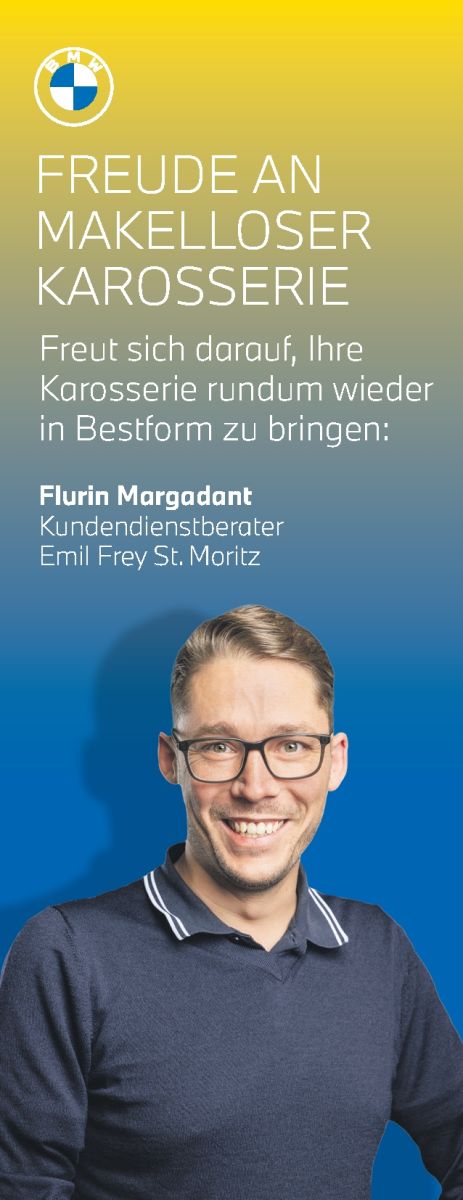



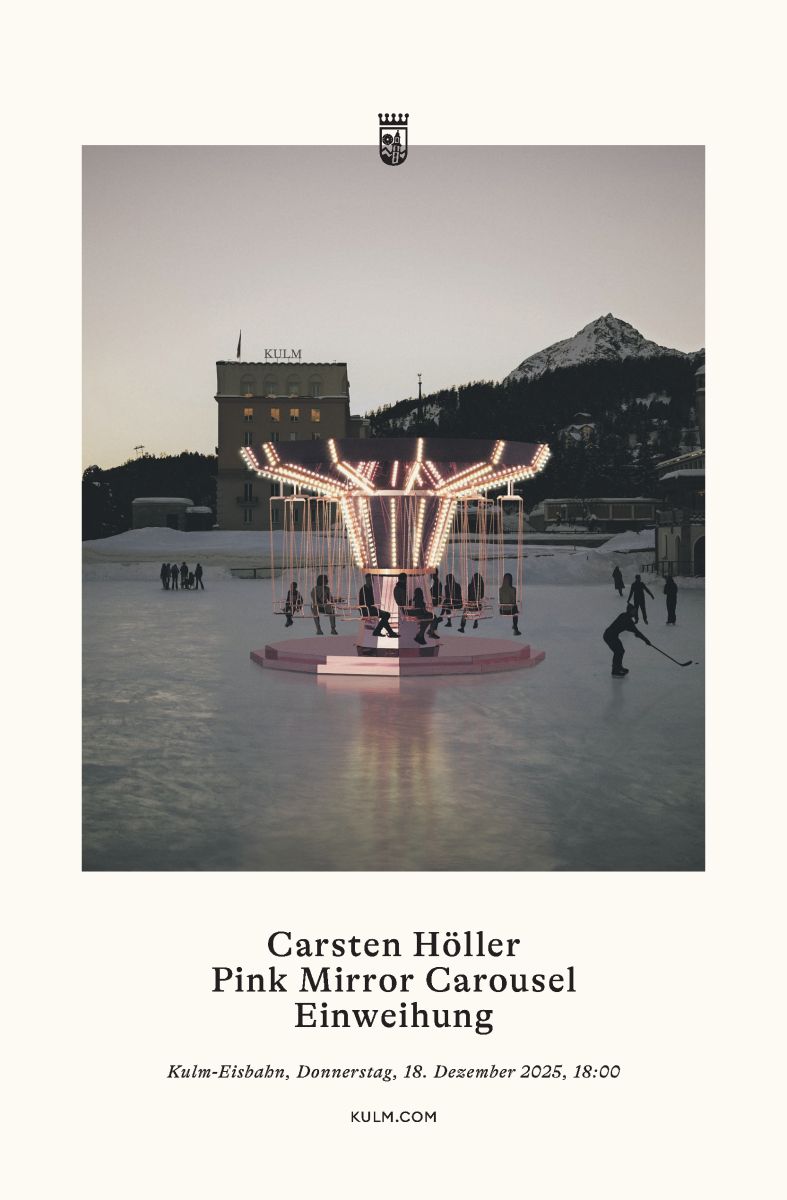
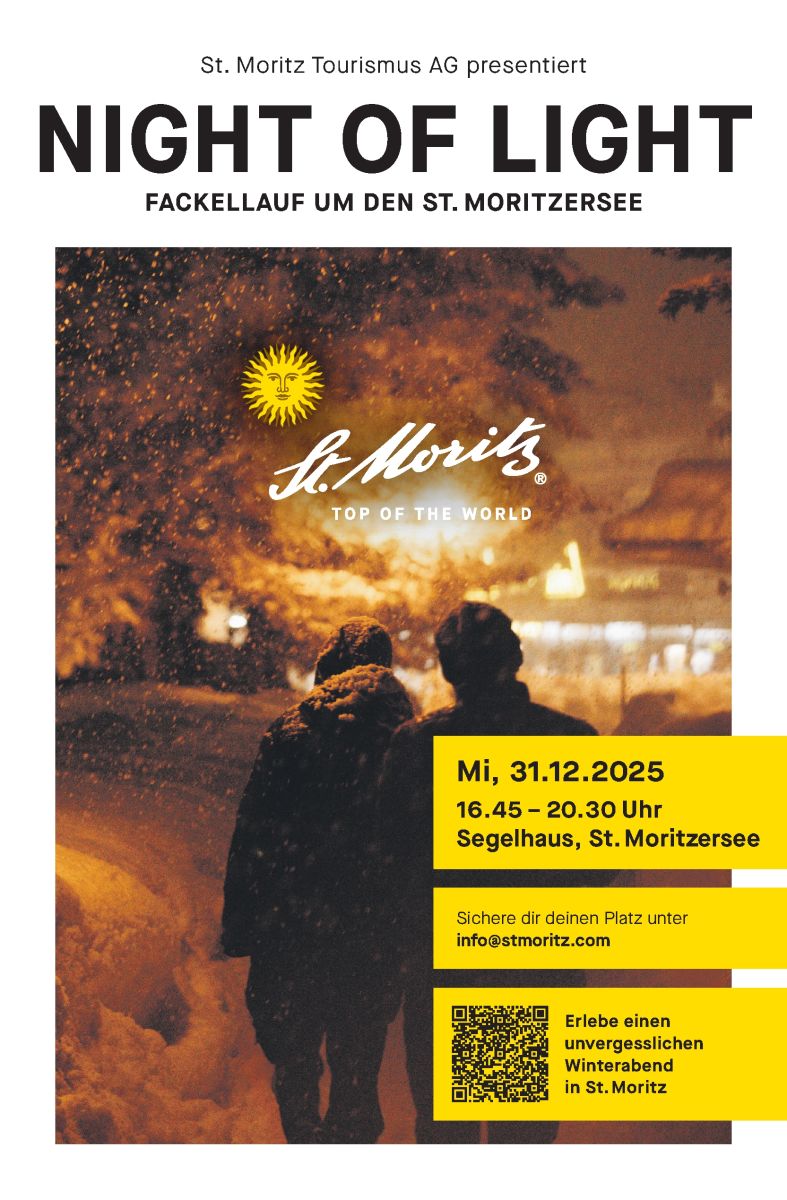
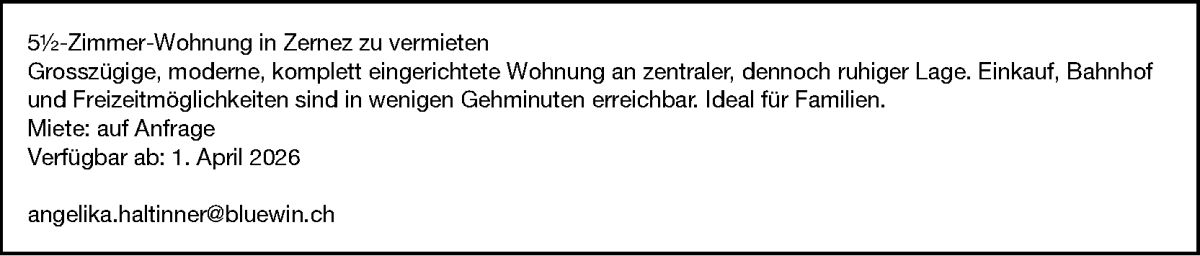


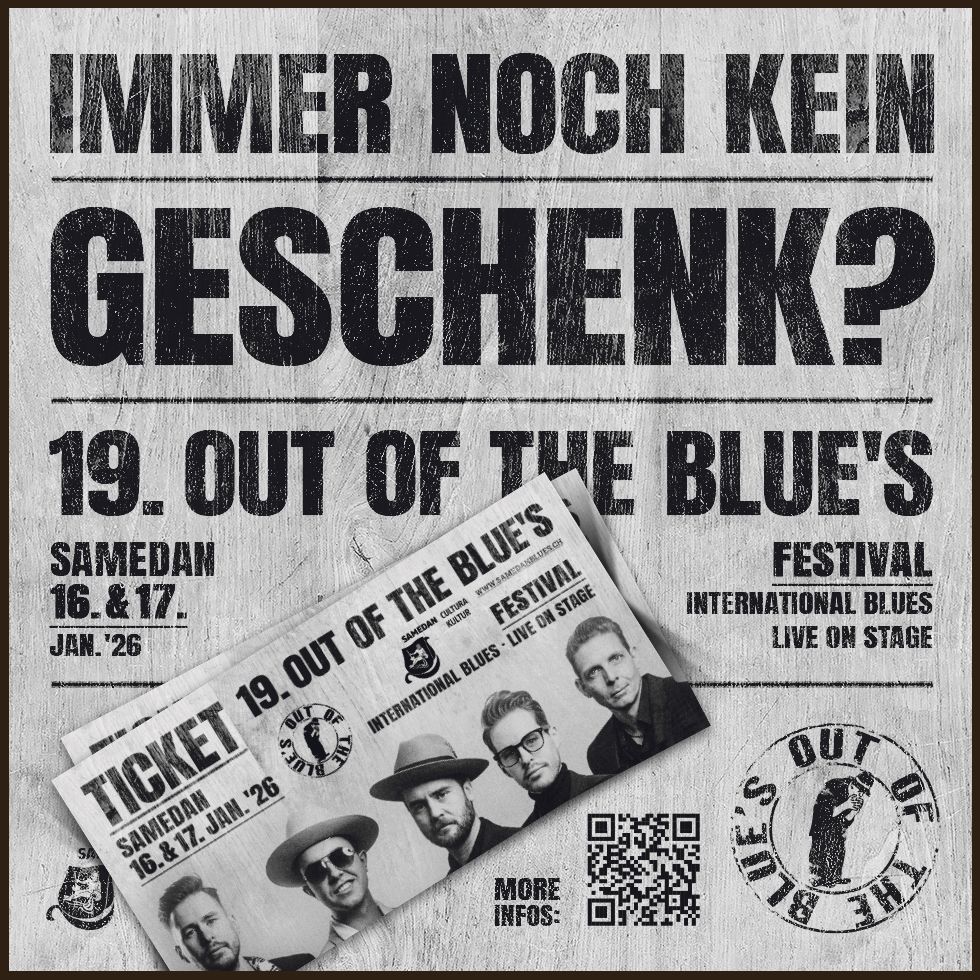
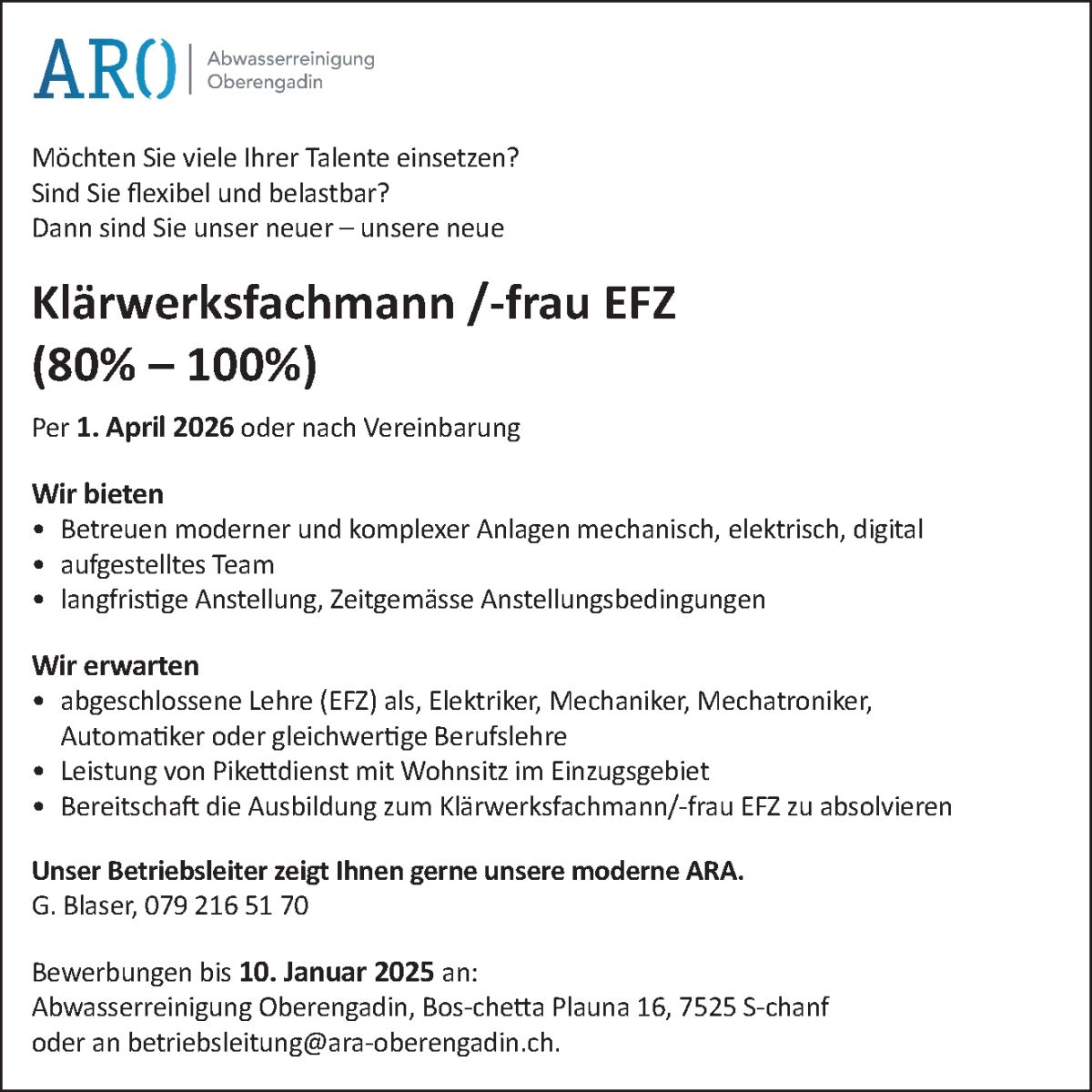

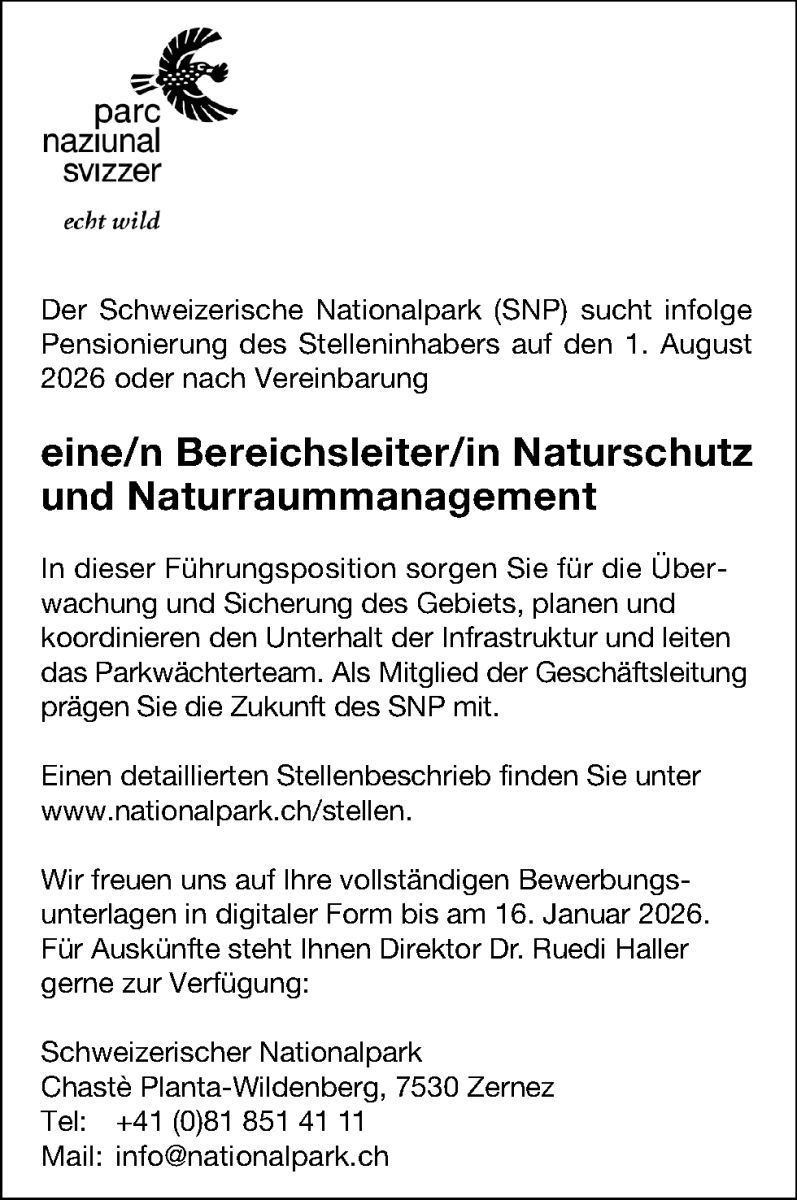
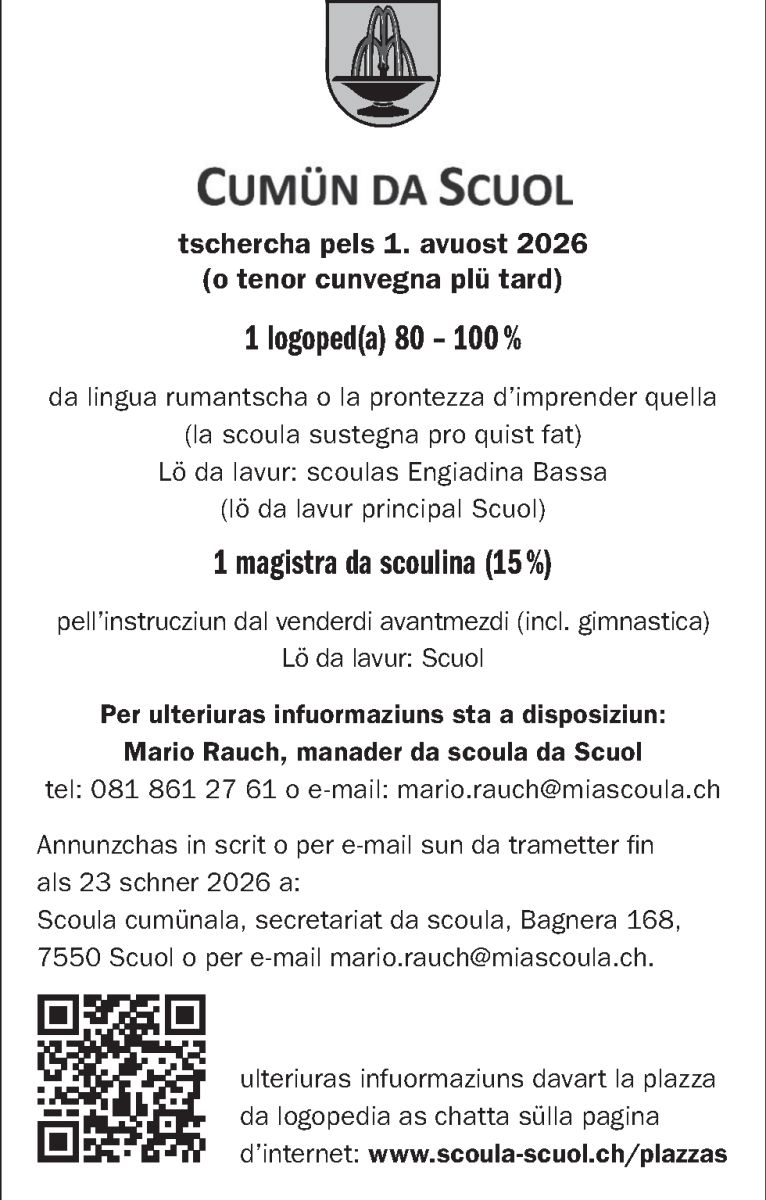
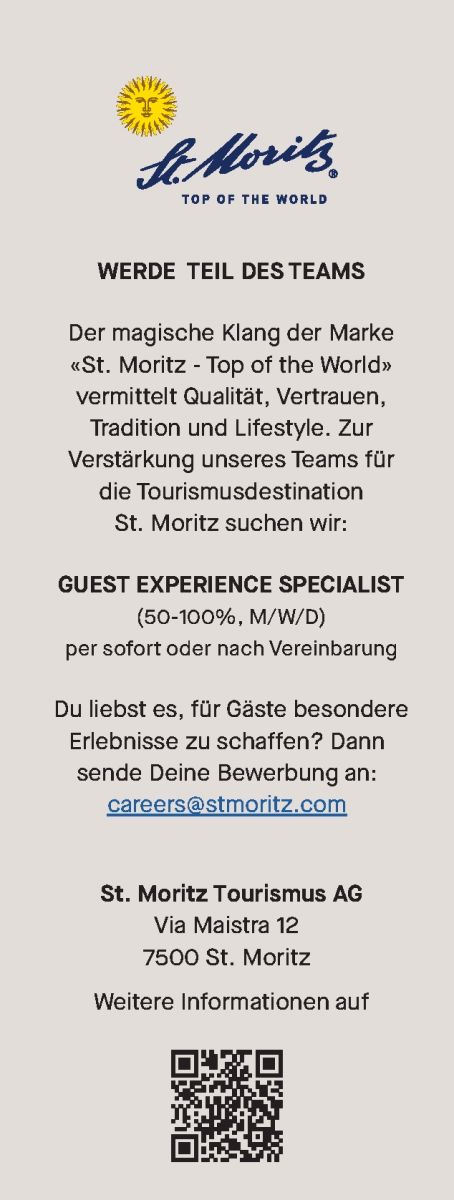


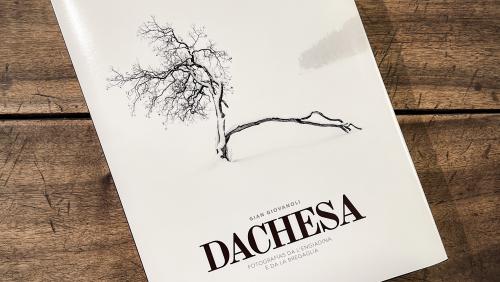

Diskutieren Sie mit
Login, um Kommentar zu schreiben