Samantha Oprandi ist in Susch aufgewachsen. «Bei vier Schülern in der Kleinklasse aus zwei Dörfern hatte man den totalen Durchblick», beschreibt die heute 34-Jährige die Zeit von damals. Abends trafen sich die Kinder zum «Giö da plan»-Spiel oder ärgerten die Nach- barn mit Klingelspielen. Umgeben von Flohmärkten, Turnvereinen, Tradition, Nähuntericht und Caramellas verbrachte sie eine unbeschwerte Kindheit. «Rückblickend denke ich, dass das Aufwachsen ohne die heutige Elektronik und den Erwartungsdruck, aber mit einem Hauch von Naivität etwas sehr Befreiendes hatte», blickt sie zurück. «Es gab aber auch Momente, die unschön waren, zum Beispiel, wenn man von jemandem geärgert wurde. Dann zogen gleich alle mit, es wollten ja alle gut dastehen», erinnert sie sich. «Damals wurde solchen Problemen keine grosse Beachtung oder Bedeutung beigemessen, es hiess dann nur: «Hör nicht hin, das wird schon wieder, stell dich nicht so an.»
Heute fühlt sie sich als Sales Consultant bei der Swisscom und Familienmanagerin im Engadin geborgen. «Meine Familie und ich führen ein sehr gutes Leben hier.» Dabei zieht es sie auch immer wieder aus dem Tal, irgendwo in die Wärme. «In einem Grenzgebiet zu leben, hat auch seine Vorteile.» Woanders zu leben, darüber hat die in St. Moritz wohnhafte Engadinerin auch schon nachgedacht. Dann nämlich, wenn es in beruflicher Hinsicht keine Perspektiven mehr gibt.
Wenn Oprandi das Engadin in drei Worten beschreiben müsste, dann wäre es: Tradition, Pachifig und Verbissenheit. Letztgenanntes führt sie auch aus. «Veränderungen im Engadin vorzunehmen, empfinde ich als schwierig, denn der Gegenwind ist gross. Eine gewisse Offenheit fehlt», ist sie etwas enttäuscht. «Es wird vieles thematisiert und versprochen, jedoch hapert es bei der Ausführung. Ich denke, vieles könnte gelöst werden, wenn man nicht so viel um den heissen Brei reden würde.»
Autorin: Mirjam Spierer-Bruder



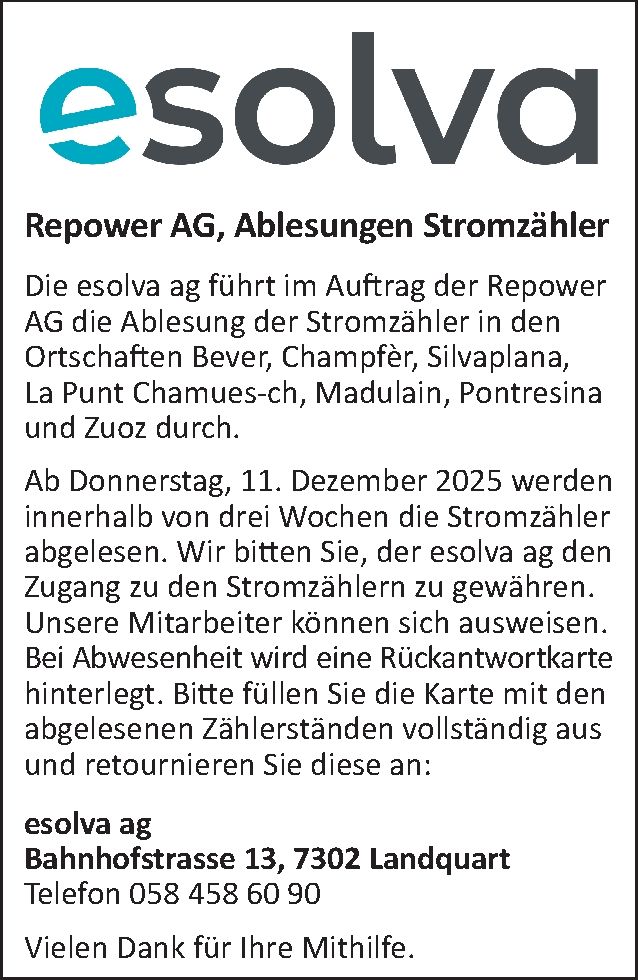














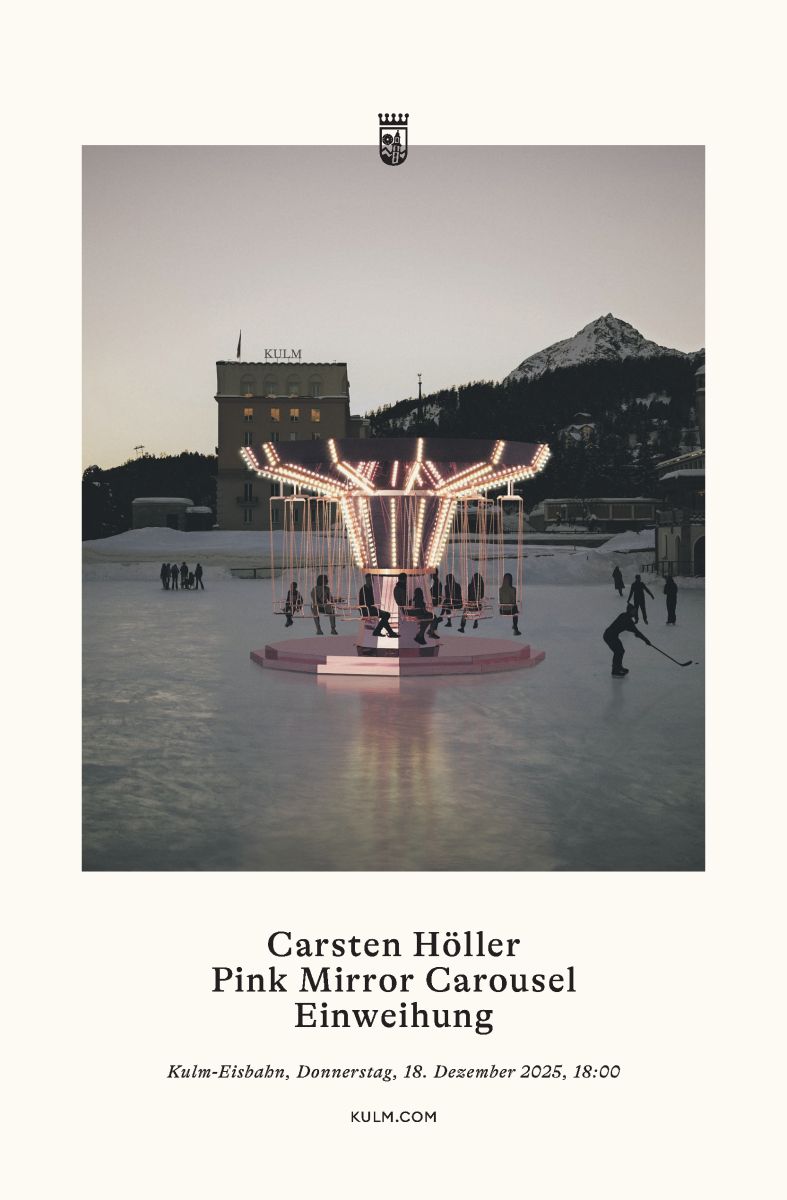

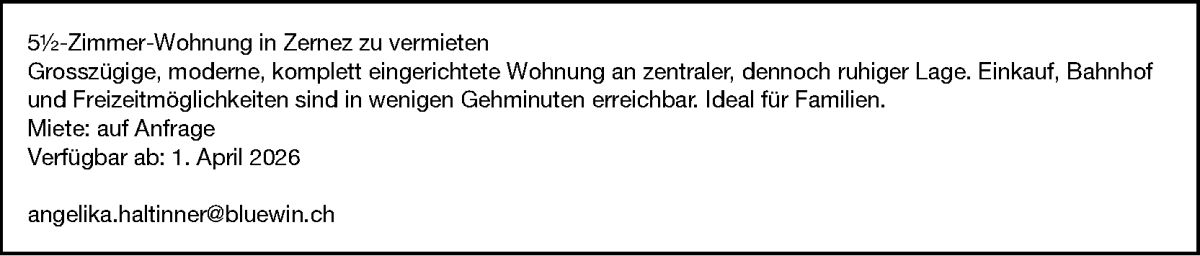



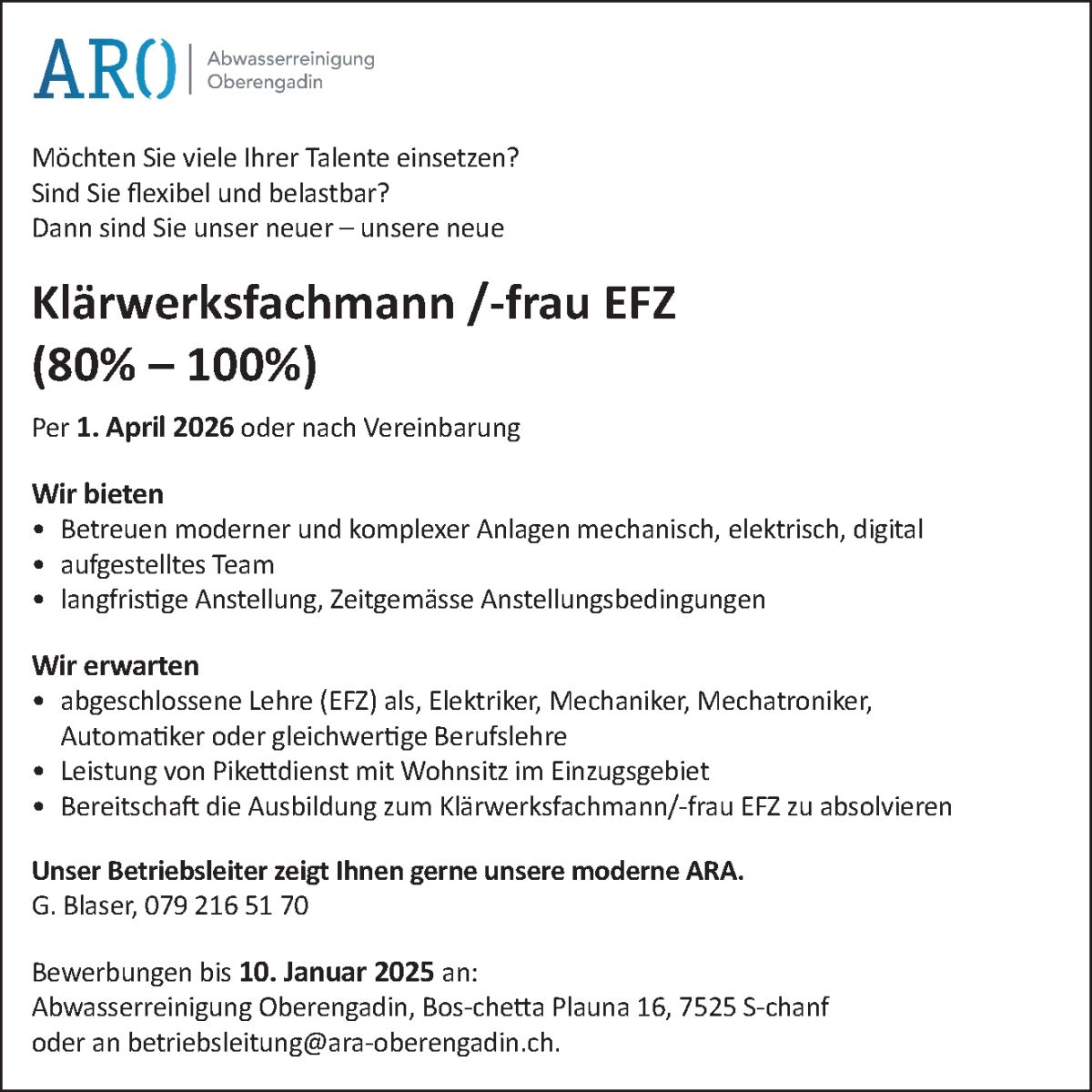







Welch wahre Worte zum Thema 'verbissenheit' - danke Samantha Oprandi! Vielleicht wirkt (endlich) der Spiegel einer Einheimischen.
Bain descrit, Samantha, gratulesch !