Engadiner Post: Herr Hofstetter, auf einer Skala von eins bis zehn, in welchem Zustand befinden sich die Bündner Gewässer?
Radi Hofstetter: Eher am unteren Ende, eine drei oder eine vier muss ich sagen.
Warum?
Wir haben recht viel gemacht bezüglich Renaturierungen, und auch in der Frage der Restwassermenge konnten wir uns mit verschiedenen Kraftwerken einigen. Teil 1 des Gewässerschutzgesetzes wird bis in rund zwei Jahren im ganzen Kanton umgesetzt sein. Also könnten wir uns eigentlich auf die Schultern klopfen ...
... und warum machen Sie es nicht?
Mit dem Klimawandel haben wir immer extremere Unwetter mit Hochwassern und Murgängen, die unsere Fischbestände dramatisch reduziert haben. Im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt wird nicht einmal mehr die Hälfte der Fische gefangen.
Trotz Verhandlungen und Einigungen mit verschiedenen Kraftwerken: Die Sunk-/Schwall-Problematik beschäftigt die Fischer immer noch stark.
In dieser Frage geht es für die Kraftwerke wirklich ums Geld. Die Unternehmen verdienen am Markt nur noch in den Stromlücken Geld. Dann, wenn zum Beispiel in Deutschland die Sonne nicht scheint und kein Wind weht. In diesen Momenten geht es darum, möglichst rasch volle Leistung zu fahren und gleich wieder abzustellen, wenn es sich nicht mehr rentiert. Das kann im Minutentakt sein, was aufgrund der stark schwankenden Wasserstände für die Fische und die Kleinlebewesen in unseren Gewässern tödlich ist.
Wie stark ist da die Position eines kantonalen Fischereiverbandes gegenüber den grossen Kraftwerkskonzernen?
Wir kämpfen ja nicht alleine. Zusammen mit Pro Natura und WWF Graubünden verfügen wir über eine recht starke Stimme. Zudem hat sich während den letzten acht Jahren anlässlich von Gesprächen am runden Tisch mit den Kraftwerken gezeigt, dass wir zusammen einen vernünftigen Umgangston gefunden haben und dass es auch vonseiten der Kraftwerksbetreiber Kompromisse benötigt. Allerdings werden die Diskussionen in den nächsten acht Jahren weiter geführt werden müssen, und ich bin nicht davon überzeugt, dass bis 2030, wie vom Gesetz vorgeschrieben, eine Lösung gefunden ist. Das sehen wir auch in der Frage des Restwassers. Das hätte gemäss Gesetz im Jahr 2012 schweizweit umgesetzt sein sollen. Jetzt, zehn Jahre später, befinden wir uns immerhin auf der Zielgeraden.
Ein weiteres Thema ist die Verunreinigung durch Mikroplastik in den Gewässern. Wie stark trifft das den Kanton Graubünden?
Mikroplastik ist im Moment nicht das drängendste Problem für uns, könnte aber in Zukunft zum Thema werden. Grössere Sorgen bereiten die Verschmutzungen mit Pestiziden oder speziell im Engadin die Fluorrückstände von den Skiwachsen.
Das haben Sie bereits vor einem Jahr kritisiert. Nun lanciert der Kanton eine Untersuchung. Was erwarten Sie?
Die Regierung wurde aufgescheucht durch unsere Untersuchungen, welche wir zusammen mit dem «K-Tipp» durchgeführt haben. Darum hat sie drei kantonale Ämter beauftragt, in diesem Jahr eine Studie zu erstellen, um unsere Ergebnisse zu verifizieren oder zu falsifizieren.
War die Untersuchung repräsentativ?
Fischerinnen und Fischer haben rein zufällig rund 80 Proben eingesammelt, die Untersuchung ist also nicht wissenschaftlich abgestützt. Meine These ist die, dass der massive Rückgang an Seesaiblingen, vor allem im Silsersee, mit dem giftigen Abrieb der Fluorwachse der Langläufer in einem Zusammenhang stehen könnte. In unseren Untersuchungen ist lediglich geprüft worden, ob die These Hand und Fuss hat oder ob meine Überlegungen aus der Luft gegriffen sind. Leider waren die Werte alarmierend hoch. Wir konnten nachweisen, dass bis zu zwei Mikrogramm der giftigen Fluorverbindungen pro Kilogramm Eingeweide gefunden worden sind. Stoffe, die sich primär in der Leber und in der Milz anreichern, wie beim Menschen übrigens auch. Beim Menschen bewegt sich das im Bereich von Nanogrammen, also noch nicht gefährlich. Wenn die Werte so hoch wären wie bei den untersuchten Fischen, hätten wir gröbere gesundheitliche Probleme.
Auch bei diesem Thema stellt sich die Frage, was ein kantonaler Fischereiverband gegen einen internationalen Skiverband oder die mächtige Wachsindustrie ausrichten will?
Der internationale Skiverband hat bereits entschieden, dass im Spitzensport Fluorwachse ab der kommenden Saison verboten sind. Wenn das für den Breitensport nicht auch kommt, oder die Organisatoren des Engadin Skimarathons nicht aktiv werden, dann haben wir in der Tat ein Problem.
Die Industrie sagt, dass sie bereits Ersatzstoffe hat.
Es tönt gut, und geworben wird mit einer umweltfreundlichen Alternative. Fakt ist, dass das so nicht stimmt. Ich weiss von zwei Firmen, dass sie Perfluoroctan einfach durch eine Perfluorhexan-Verbindung ersetzen. Und dieses ist genauso giftig wie das Perfluoroctan, wird aber noch nicht angewendet und ist darum noch nicht verboten. Ich gehe davon aus, dass das in fünf Jahren der Fall sein wird und dann steht bereits ein drittes Produkt bereit, die sogenannten Silikane. Das sind auch Chemikalien, die von der Natur nicht auf natürliche Art abgebaut werden können. Wir werden noch lange mit solchen Problemstoffen kämpfen müssen.
Gibt es keine Alternativen?
Die gibt es. Wachse, welche auf Naturbasis gemacht sind, sich abbauen und darum unbedenklich sind. Weil nur kleine Firmen mit eingeschränkten Produktionskapazitäten solche Wachse produzieren, sind sie noch teuer. Vor allem müssen diese Firmen beweisen, dass ihre Wachse gleich schnell sind wie die herkömmlichen Produkte.
Wir haben jetzt viel über die Probleme der Bündner Gewässer gesprochen. Was gibt es Positives zu sagen?
In Kürze wird die Fischfangstatistik des letzten Jahres veröffentlicht. Ich durfte bereits einen Blick in die Statistik werfen und sehe zum Beispiel, dass letztes Jahr im Engadin erfreulich gut gefangen worden ist. Sicher auch aufgrund des Corona-Effekts mit einer deutlich höheren Anzahl an Fischern. Es sind rund 15 Prozent mehr Saisonpatente verkauft worden, vor allem aber doppelt so viele Tages- und Wochenkarten im Vergleich zu 2019. Das hat zu rund 30 Prozent mehr Ereignissen am Wasser geführt.
Fischer sind im Gegensatz zu den Jägern nicht verpflichtet, Hegestunden zu leisten. Sie müssen auch keinem Verein angehören. Warum?
Aus unserer Sicht ist das falsch. Es gäbe mehr als genug Hegearbeit zu leisten für unsere Gewässer. Wer als Fischer heute einfach das Patent löst und keinem Verein beitritt, zahlt nichts für diese wichtige, aber auch sehr aufwendige Arbeit. In den Kantonen Bern oder Solothurn beispielsweise ist das anders. Dort leistet man Hegearbeit oder man bezahlt.
Sie könnten ja als Kantonalverband aktiv werden.
Bisher hatte die Regierung wenig Musikgehör für solche Vorschläge. Ein obligatorischer Vereinsbeitrag würde eine Gesetzesänderung bedingen.
Wer heute einen Tag oder eine Woche fischen gehen will, kann das machen, ohne einen Nachweis über fischereiliche Kenntnisse erbringen zu müssen. Warum?
Anlässlich unserer Delegiertenversammlung vor drei Wochen ist auf Antrag des Fischereivereins Unterengadin entschieden worden, dass derjenige, der eine Tages- oder Wochenkarte löst, in Zukunft einen sogenannten Sachkundenachweis Fischerei (SaNa) vorlegen muss. Ich habe das bereits in die Fischereikommission gebracht. Letztendlich wird die Regierung entscheiden. Bis jetzt haben vor allem die Tourismusorte opponiert mit dem Argument, dass, wenn ein Gast fischen gehen will, man nicht von ihm verlangen kann, dass er einen SaNa-Ausweis hat.
Was sagen Sie?
Die meisten Leute, die fischen, haben schon Erfahrung. Häufig fischen sie in anderen Kantonen oder Nachbarländern und sind demzufolge im Besitz eines Ausweises. Wenn nicht, können sie sich durch einen professionellen Guide oder einen Begleiter mit einem SaNa-Ausweis begleiten lassen, entsprechend ist auch der Antrag formuliert.
An der gleichen Delegiertenversammlung wurde ein Antrag auf eine massive Fangzahlbeschränkung nur knapp abgelehnt. Sind die Fischer sensibler auf solche Themen geworden?
Die Jungen sind viel affiner bezüglich der Umweltproblematik, und sie überlegen sich genau, was es bedeutet, einen Fisch dem Gewässer zu entnehmen. Dieses Umdenken freut mich sehr. Ein Teil der älteren Generation war noch an den Überfluss gewohnt und kann oder will sich nicht umstellen.
Mit der Besatzung von Gewässern wird heute sehr viel Aufwand betrieben. Wie erfolgreich ist die Fischbesatzung?
Nicht sehr erfolgreich. Wir stellen fest, dass Fische, die nach vier bis sechs Monaten in einem Rundbecken aus der Fischzuchtanstalt in den Bach kommen, gegenüber den naturverlaichten Fischen deutlich im Nachteil sind. Grundsätzlich halten wir an der 2016 verabschiedeten Strategie fest, nur so viel Besatzung wie nötig zu betreiben. Also nur noch dort, wo Naturverlaichung nicht funktioniert. Sei es wegen fehlenden Unterständen oder der Sunk-/Schwall-Problematik.
Ist es realistisch, eines Tages ganz ohne Besatzung auszukommen?
Wenn alles renaturiert wäre, keine Giftstoffe mehr in die Gewässer gelangen würden und die Sunk-/Schwall-Problematik gelöst wäre, dann ja. Früher hat es ja auch ohne Besatz funktioniert.
Früher waren die Gewässer auch nicht so sauber wie heute. Die Fische fanden mehr Nahrung vor.
Vor 100 Jahren, als die Abwasseranreicherung einsetzte und die Gewässer überdüngt waren, sind die Fischbestände explodiert. Das war vollkommen unnatürlich. Dorthin wollen wir auf keinen Fall zurück. Wir haben heute eher nährstoffarme Gewässer, die eine bestimmte Anzahl Fische ernähren können. Wenn nun diese Gewässer noch zusätzlich verschmutzt werden, durch Pestizide beispielsweise, leidet der Fischbestand.
Darum empfehlen die Fischer ein Ja zur Trinkwasser- und Pestizid-Initiative, über welche am 13. Juni abgestimmt wird?
Richtig. Zusammen mit vielen anderen Verbänden, die sich um die Umwelt kümmern. Ich trinke selber eher Bier, aber meine Kinder trinken sehr gerne Wasser aus dem Hahn, bis jetzt mit gutem Gewissen. Wenn ich mir die aktuellen Messresultate vor Augen führe, habe ich gewisse Bedenken und frage mich, ob sie das in Zukunft auch noch können.
Wir dürfen unsere Böden und unsere Oberflächen- respektive Grundwasser nicht weiter vergiften. Die modernen Pestizide sind höchsttoxische Nervengifte, welche unsere Kleinlebewesen in den Gewässern, zum Beispiel den Bachflohkrebsen, von denen wiederum die Fische leben, töten. Ich habe den Eindruck, dass in Graubünden die Meinung vorherrscht, dass das vor allem ein Problem des Mittellandes ist. Leider ist dem nicht so. Pestizide sind sehr flüchtige Stoffe, welche durch den Wind über grosse Flächen verteilt werden. Ein Beispiel sind die Pestizidrückstände, welche von den Apfelplantagen aus dem Vinschgau bis in den obersten Teil der Val Müstair transportiert werden, wie eine Studie nachgewiesen hat.
Wird sich die Fischerei in den nächsten Jahren verändern?
Verändern wird sich das Verständnis der Fischer, mit weniger gefangenen Fischen auch glücklich zu sein. Weiter bin ich überzeugt, dass die grossen Renaturierungsprojekte Früchte tragen werden. Wenn der untere Abschnitt zwischen Bever und La Punt revitalisiert ist oder wenn wir uns die Aufweitung des Alpenrheins vor Augen führen, sind das sehr wichtige Projekte für eine attraktive Fischerei. Auch weil in den letzten Jahrzehnten bei der baulichen Umsetzung solcher Projekte sehr viel gelernt worden ist und auf die Bedürfnisse der Fische Rücksicht genommenen wird. Die Fische schätzen diese neuen Habitate. Auch da lohnt sich ein Blick in die Fangstatistik. Die Äschen werden heute nicht mehr bei der Ochsenbrücke zwischen Celerina und Samedan gefangen, sondern weiter talabwärts in einem renaturieren Abschnitt.
Am 1. Mai beginnt in weiten Teilen des Kantons die Fischerei. Was bedeutet Ihnen das Fischen?
Ich bin bereits als Vierjähriger mit meinem Vater, der im Luzernischen einen Bach gepachtet hatte, fischen gegangen. Ich habe oft Fischerferien gemacht, besitze seit elf Jahren ein eigenes Blockhaus an einem der letzten schönen Lachsflüsse in British Columbia und war die letzten Jahre – bis Corona kam – jeweils im Sommer dort Lachse fischen. Kurz: Die Fischerei ist mir sehr wichtig. Es geht mir nicht um das, was ich am Abend nach Hause bringe, sondern um das Erlebnis in der Natur.
Dient die Fischerei einem höheren Zweck als nur Fische zu fangen?
Für mich ist Fischen ist eine Philosophie, eine Lebenseinstellung. In der Natur, am Gewässer kann ich mich am besten erholen. Dazu kommt auch ein gesellschaftlicher Aspekt. Wenn ich nach dem Fischen mit Kollegen zusammensitze, ein Feuer mache, eine Wurst grille und ein Bier trinke, ist das Lebensqualität.
Im Gespräch mit Radi Hofstetter
Menschen, die etwas zu sagen haben, Themen, die bewegen: In der Serie «Im Gespräch mit ...» werden interessante Persönlichkeiten in unregelmässigen Abständen zu den verschiedensten Themen interviewt. Heute ist es Radi Hofstetter. Der 64-Jährige kommt aus dem Kanton Luzern und ist nach seinem ETH-Studium in Zürich bei der Firma Hamilton Medical Bonaduz gelandet, wo er im Bereich Robotik tätig war und Mitglied der Geschäftsleitung wurde. Vor drei Jahren hat er sich frühpensionieren lassen. Ebenfalls seit drei Jahren ist er Präsident des Kantonalen Fischereiverbandes Graubünden.
Autor: Reto Stifel
Foto: Daniel Zaugg



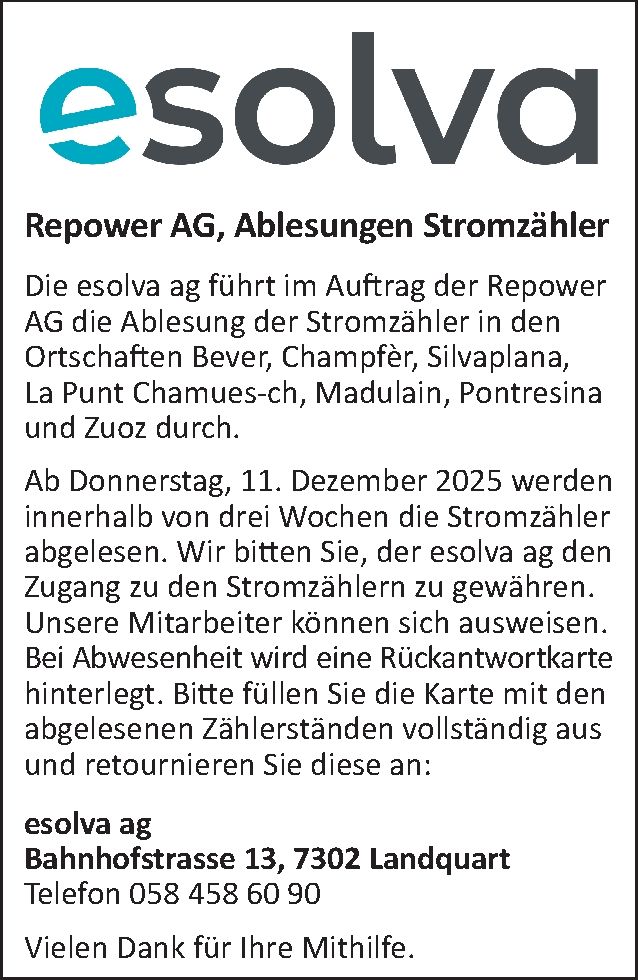














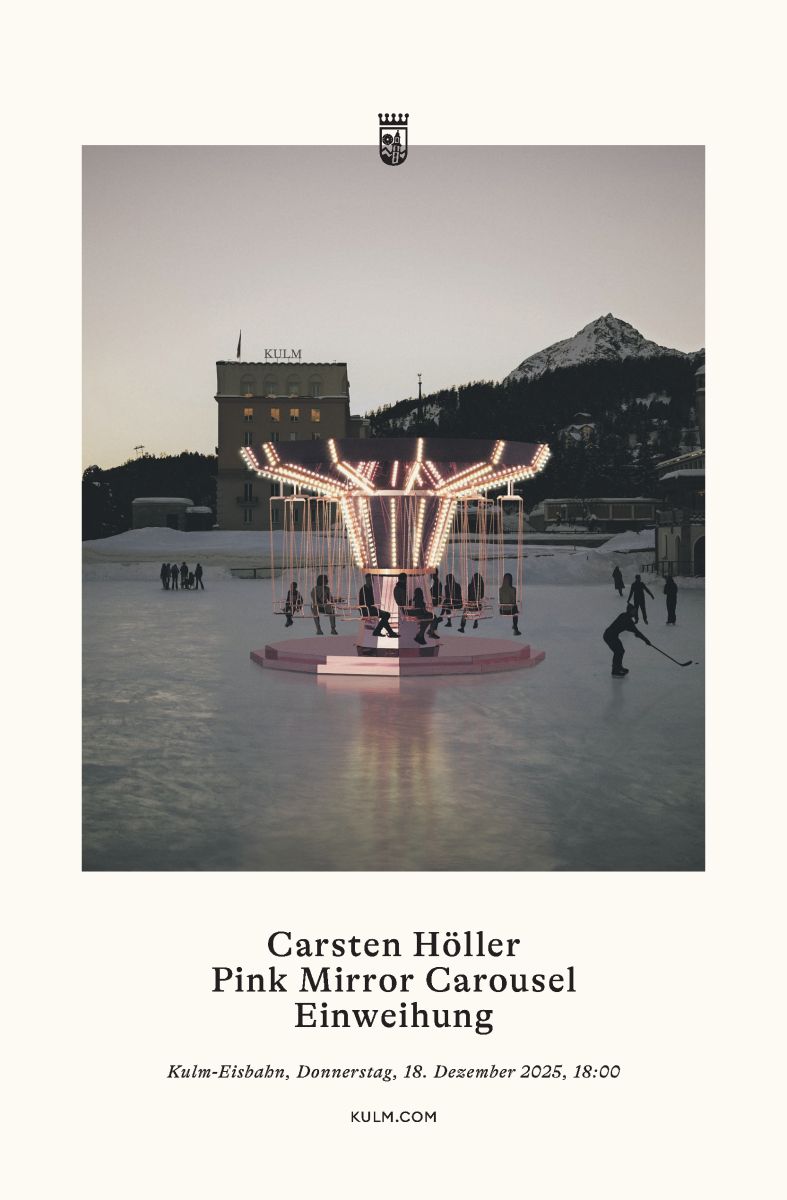

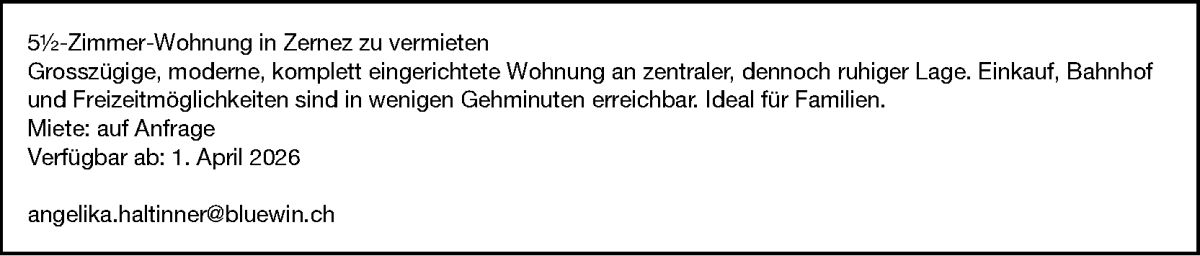



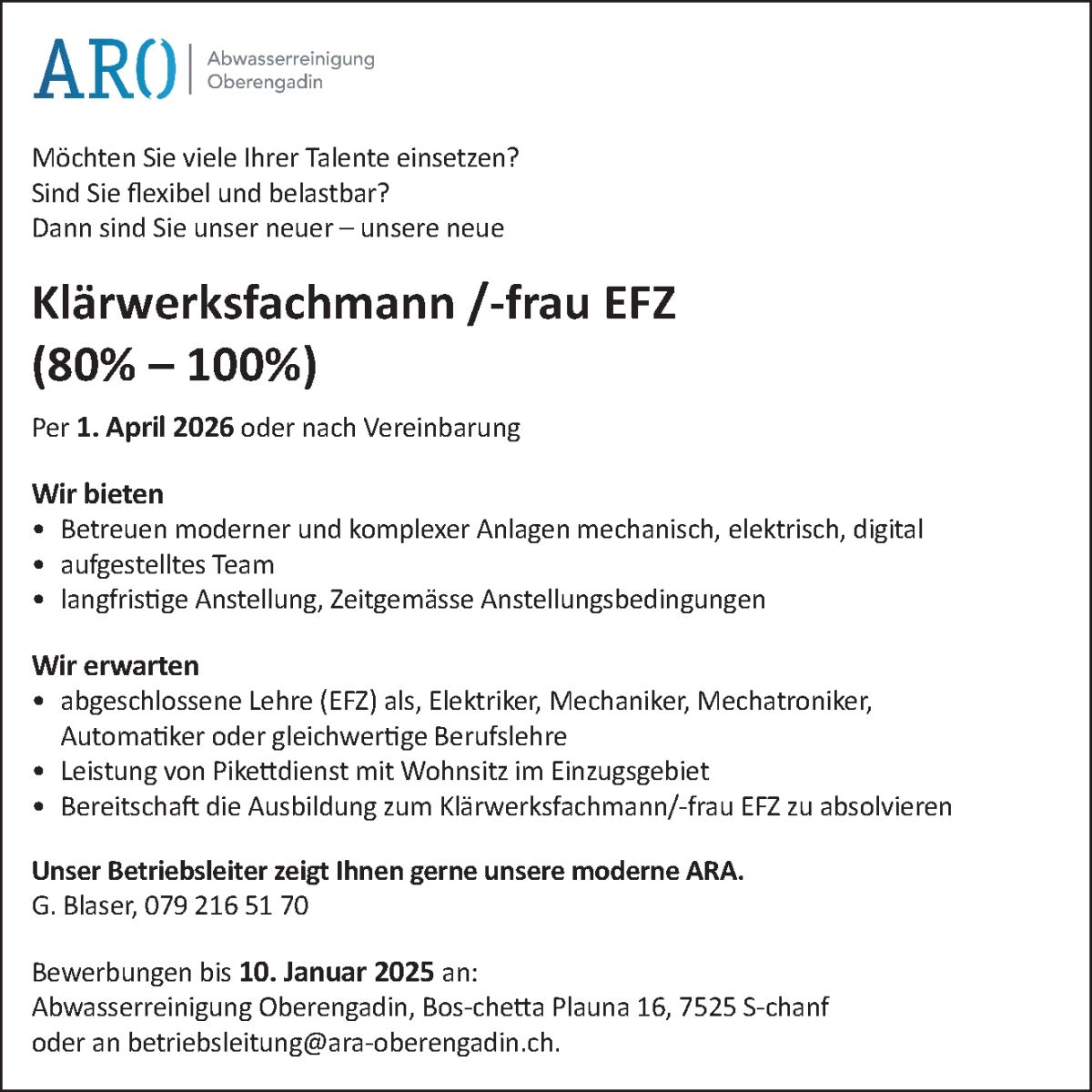






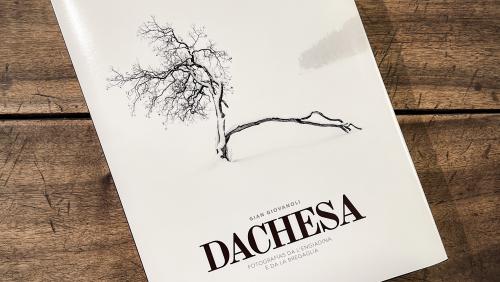

Diskutieren Sie mit
Login, um Kommentar zu schreiben