Spätestens nach dem Nein des Walliser Stimmvolkes 2018 schien die Olympia-Diskussion in der Schweiz für lange Zeit vom Tisch. Selbst der Schweizer Sportdachverband Swiss Olympic verordnete damals einem Marschhalt. Dies nach acht gescheiterten Bemühungen alleine in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Trotzdem ist in diesem Frühjahr die Olympia-Diskussion fast aus dem Nichts wieder aufgeflammt. Und seit der Bekanntgabe der Resultate einer Machbarkeitsstudie am vergangenen Mittwoch ist klar: Das Thema Olympia ist in der Schweiz wieder auf dem Tapet.
IOC unter Druck
Warum dieser Sinneswandel? Das Internationale Olympische Komitee (IOC) steht massiv unter Druck. Zum einen muss es den Worten endlich Taten folgen lassen und sich vom Gigantismus verabschieden. Sotschi 2014, Rio de Janeiro 2016, Pyeongchang 2018 und jüngst Peking 2022 waren samt und sonders abschreckende Beispiele mit absurden Investitionen in eine Infrastruktur, welche damals zu grossen Teilen nicht vorhanden war und heute oft nicht mehr genutzt wird. Zum anderen erhält das IOC die Quittung für sein Streben nach immer mehr und für die undurchsichtige Vergabepolitik: Das Misstrauen ist gross, für die Austragung 2030 fehlt bis heute ein offizieller Bewerber. Darum ist das IOC im Frühjahr proaktiv auf die Schweiz zugegangen mit dem Anliegen, eine mögliche Kandidatur zu prüfen.
Zeichen für Sinneswandel sind da
Dass Swiss Olympic auf die Avancen des IOC eingetreten ist, ist zu begrüssen. Beim allmächtigen internationalen Sportverband sind Zeichen zu erkennen, dass es ihm ernst ist mit den Nachhaltigkeitsbeteuerungen – ökologisch und ökonomisch. Redimensionierte und dezentralisierte Spiele sollen nun möglich sein, der Vergabeprozess wurde angepasst, eine Defizitgarantie seitens des Staates wird nicht mehr verlangt. Und der Entscheid Italiens, für die Spiele 2026 keine eigene Bobbahn zu bauen, ist vom IOC schon vor längerer Zeit gefordert worden.
Die vorliegende Machbarkeitsstudie zeigt, dass der von der Schweiz verfolgte Weg in die richtige Richtung geht. Die Spiele sollen dezentral in allen Landesteilen durchgeführt werden. Dies fast ausschliesslich auf vorhandenen Sportinfrastrukturen, die auch für Grossanlässe immer wieder genutzt werden. Auf den Bau von Athletendörfern wird verzichtet, die Schweiz verfügt gemäss den Promotoren über genügend Übernachtungsmöglichkeiten. Dieser neue Ansatz führt logischerweise zu markant tieferen Kosten. 1,5 Milliarden Franken soll das Organisationsbudget betragen, «mehr oder weniger ohne finanzielle Mittel der öffentlichen Hand», sagt Urs Lehmann, Präsident von Swiss-Ski und eine der treibenden Kräfte hinter den Olympiaplänen.
Es gibt offene Fragen
Alleine diese Formulierung zeigt, dass es offene Fragen gibt. Erstens die Finanzierung: Nicht Bestandteil des Organisationsbudgets sind beispielsweise die Investitionen in die Infrastruktur, vor allem in die Transportinfrastruktur. Und auch die Kosten für die Sicherheit werden von der öffentlichen Hand zu tragen sein, das alleine dürften mehrere hundert Millionen Franken sein. Da muss der Bevölkerung möglichst rasch reiner Wein eingeschenkt werden.
Zweitens die Frage der Unterbringung von Athletinnen und Athleten sowie Begleittrossen. Die Spiele finden im Normalfall in der ersten Februarhälfte statt, dann ist touristische Hochsaison, und ein Hotelier wird kaum bereit sein, seine Stammgäste während dieser Zeit auszuquartieren. Drittens der Zeitdruck: Innerhalb von knapp sechs Jahren eine solche Kiste auf die Beine zu stellen ist – vorsichtig ausgedrückt – sehr ambitioniert. Allerdings kann das auch als Vorteil gesehen werden: Je weniger Zeit, desto stärker muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Keine Bittstellerrolle einnehmen
Ohne Zweifel hat das Vertrauen breiter Bevölkerungsschichten in das Internationale Olympische Komitee in den vergangenen Jahren stark gelitten. Solches Vertrauen wieder herzustellen, ist schwierig, zumindest aber sollte man dem IOC die Gelegenheit bieten, den Tatbeweis zu erbringen.
Und da ist es durchaus erlaubt, als möglicher Ausrichter von der Bittstellerrolle wegzukommen und klare Bedingungen zu stellen: Eine Defizitgarantie seitens des Staates ist keine Option und darf nicht verhandelbar sein. Die Anforderungen an die Infrastruktur müssen realistisch sein, und zwar so, dass sich bestehende Sportanlagen tatsächlich ohne grossen Investitionsaufwand nutzen lassen. Und die Möglichkeit, den Austragungstermin beispielsweise in die zweite Januarhälfte – also ausserhalb der Hochsaison – vorzuverschieben, muss möglich sein.
Es waren selbstbewusste Töne, welche die Olympia-Promotoren an der Medienkonferenz vom Mittwoch angeschlagen haben. «Wir diktieren die Regeln», wurde da beispielsweise gesagt. Oder: «Die Spiele passen sich dem Austragungsland an und nicht umgekehrt.» Dieses selbstbewusste Auftreten ist auch gegenüber dem mächtigen IOC nicht nur zu wünschen, sondern unabdingbar, wenn die Spiele ab 2030 tatsächlich einen Wendepunkt in der olympischen Geschichte darstellen sollen.
Autor: Reto Stifel
Foto: Daniel Zaugg




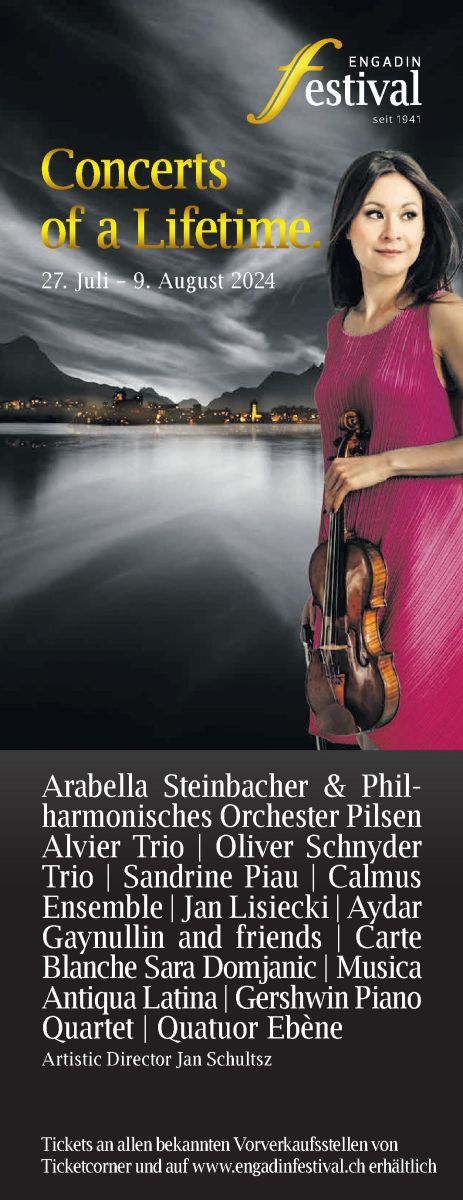



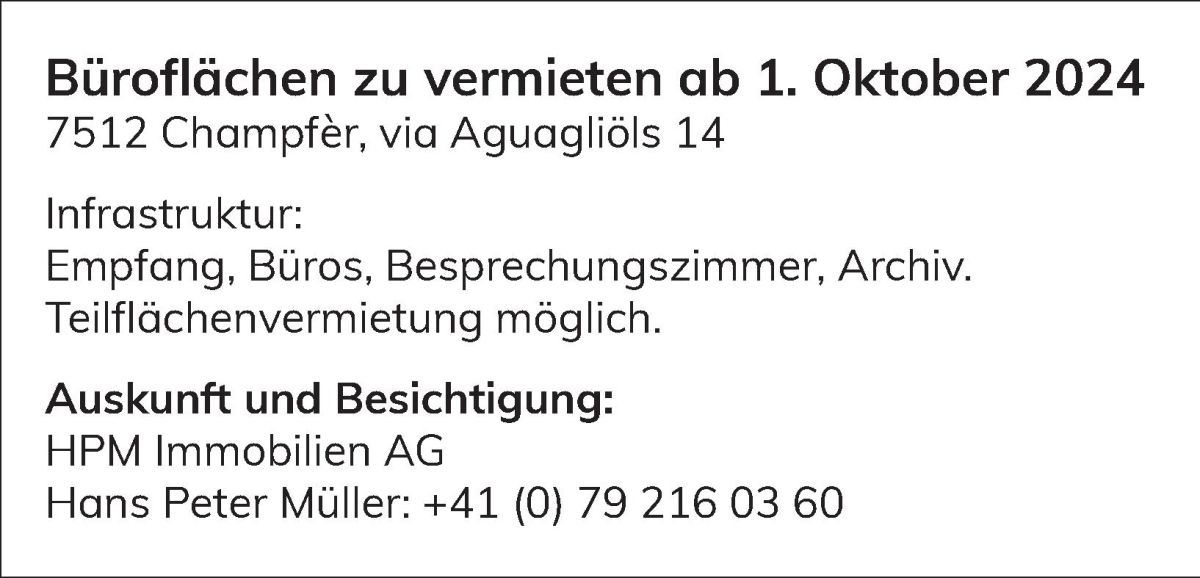



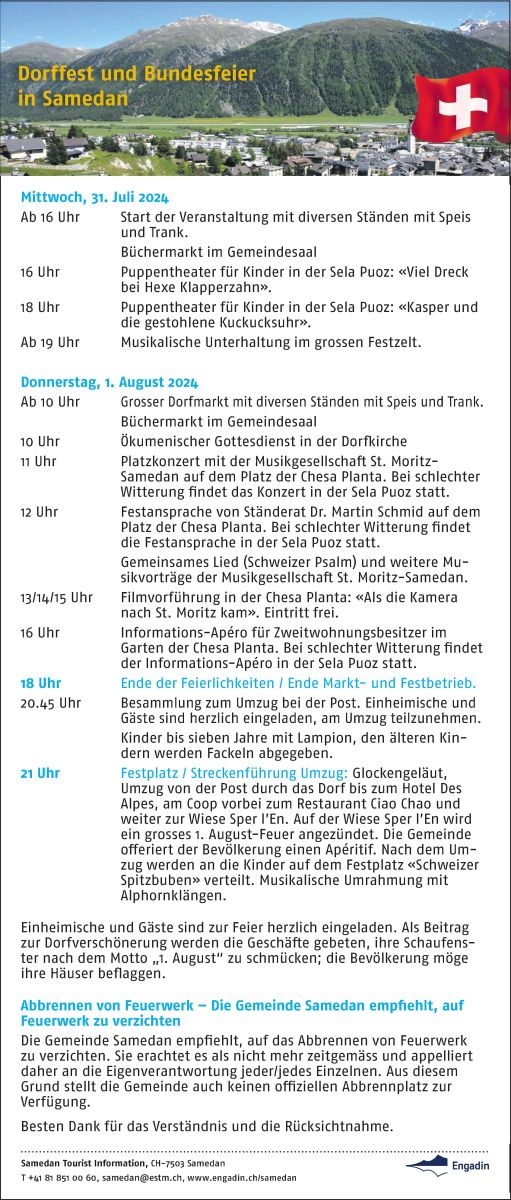










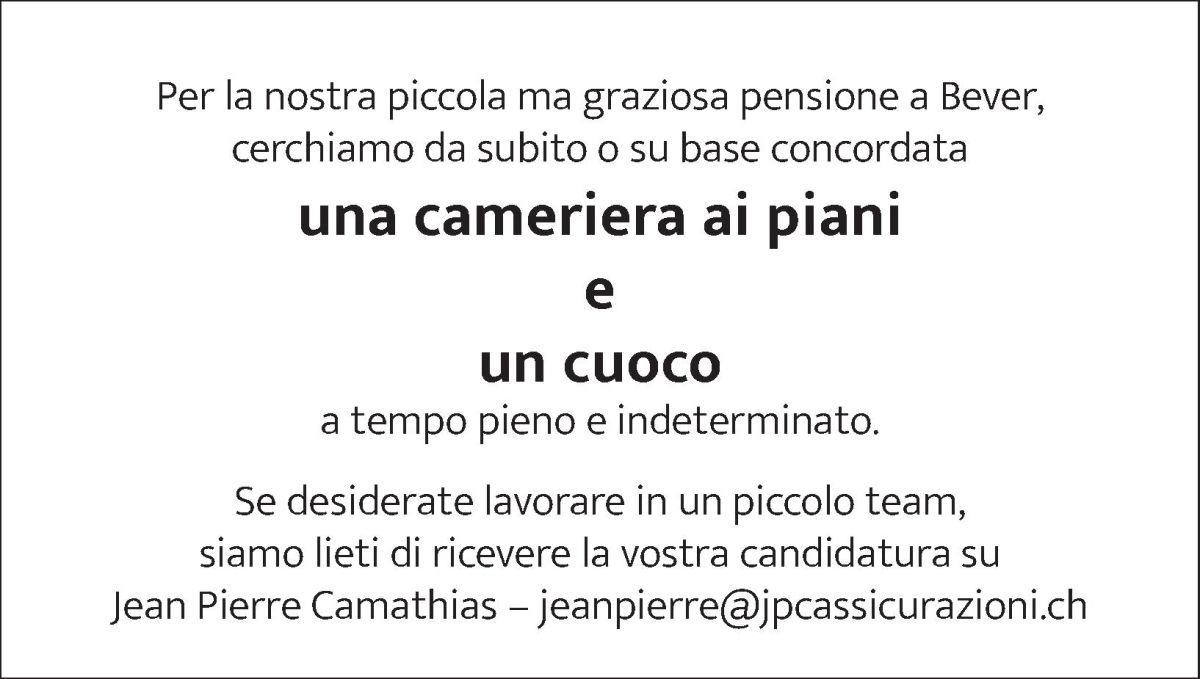





Diskutieren Sie mit
anmelden, um Kommentar zu schreiben