«Ich mochte Rilke nicht, als ich vor bald 50 Jahren mein Germanistikstudium begann und erste Vorlesungen über ihn hörte», schreibt Manfred Koch in seinem Vorwort zum knapp 550-seitigen Buch «Rilke - Dichter der Angst». Zu süsslich sei ihm der Autor von weltliterarischem Rang gewesen, zu klischeehaft. Und doch hat der Literaturwissenschaftler später über Rilke promoviert und legt nun dessen umfassende Biographie vor. Um zu verstehen, was die Faszination Rilkes ausmacht und warum Manfred Koch von dieser Persönlichkeit und seinem Lebenswerk nicht mehr wegkommt, war ein Besuch in der Schreibstube des Autors unumgänglich. Auch dort ist Rilke allgegenwärtig, in Form eines Bücherturms mit Rilke-Literatur, von Zitaten und natürlich der noch druckfrischen Biographie.
Manfred Koch, es gibt bereits mehrere Biographien von Rilke. Warum braucht es noch eine?
Bei so einem Autor kann man alle 20 bis 30 Jahre noch einmal einen Gesamtblick auf das Leben und Werk werfen. Die letzten grossen Biographien sind alle aus den Achtziger- und Neunzigerjahren. Damals gab es andere Akzentsetzungen als heute. Ich biete kein völlig neues Bild von Rilke, das geht gar nicht angesichts dessen, wie er erforscht wurde. Mein Akzent ist aber bereits im Titel zu lesen: Dichter der Angst.
Was hat es mit diesem Titel auf sich?
Ich äussere in meinem Buch den Verdacht, dass Rilke vielleicht ein Missbrauchsopfer seiner Mutter war. Es gibt ein extrem problematisches Mutter-Sohn-Verhältnis. In einem Gedicht schreibt Rilke beispielsweise: «Ach wehe, meine Mutter reisst mich ein». Ich bin kein Psychoanalytiker, aber er selber reflektiert in seinen Schriften, wie aus tiefster Verstörung bis hin zur psychischen Krankheit Kunst hervorgehen kann. Der Zentralbegriff, den ich zitiere und ins Zentrum stelle, lautet: «Meine Kunst ist ein Dingemachen aus Angst».
Aber Rilke galt nach dem Zweiten Weltkrieg doch als Trostdichter, er wurde sogar als «Sinnstifter in der Finsternis» bezeichnet?
Ja. Ein berühmter Vers von ihm lautet: «Wer spricht von Siegen, überstehn ist alles». Nachdem er den mehr oder weniger autobiographischen Roman «Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge» geschrieben hatte, war er in einem Grenzbereich zur Psychose. Die Angstzustände waren so furchtbar, dass er das einzige Mal in seinem Leben überlegt hat, eine Psychotherapie anzutreten. Dann hat er seine später berühmt gewordenen Elegien geschrieben und festgestellt, dass er sich über die Kunst selbst therapieren kann.
Der «Malte» war laut Ihren Ausführungen im Buch ein Grund, warum Sie Rilke doch noch überzeugt hat.
Genau. Der «Malte» ist ein fantastischer Angstroman. Jemand schrieb in den Vierzigerjahren, das sei eine «great symphony of fear». Es war wohl ein Versuch, über seinen Kindheitskomplex im Stil der Psychoanalyse über sich selbst klar zu werden und sich so selbst zu heilen. Nur ging es schief. Bis zu seinem Tod mit 51 Jahren blieb er verstört. Er hat sich eher in die psychische Krankheit hineingeschrieben.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Rilke eine komplexe Persönlichkeit hatte, charismatisch war, aber auch ein sehr erfolgreicher Schmarotzer. Können Sie dies erläutern?
Rilke war eigentlich überhaupt nicht lebenstüchtig, praktisch vollkommen unfähig. Er hat sich auf eine Art durchgeschlagen, wo man nur staunen kann. Er hatte im Grunde eine aristokratische Lebensart, stieg nur ab in den besten Hotels, fuhr Erste Klasse in der Eisenbahn. Er war dauernd unterwegs und verkehrte ab 1902 überwiegend in hochadligen Kreisen. Er hat vor allem auf Frauen eine grosse Faszination ausgeübt, obwohl er von sich selber gesagt hat, dass er kommunikationsunfähig sei. Jedes Gespräch sei für ihn zu viel. Damit schuf er um sich eine Aura eines höheren Wesens, eine Aura der Heiligkeit. Die Frauen fassten sofort Vertrauen zu ihm, obwohl er ganz offen sagte, dass das Einzige, was ihn interessiere, er selbst sei.
Rilke wurde ja nicht nur im deutschsprachigen Raum verehrt, sondern auch im angelsächsischen. Woher kommt das?
Ja, das ist irre. Es gibt an die zwanzig Übersetzungen der Duineser Elegien ins Englische. Und das von einem Autor, der null Interesse an Grossbritannien und schon gar nicht an den USA hatte. Dieser Erfolg hat mit seiner Grundhaltung zu tun, man müsse die tiefsten Ängste und Verstörungen durchstehen und irgendwann ergebe sich das gelingende Wort. Er war überzeugt, dass Leben nur leidvoll lebenswert sei, denn nur dann seien existenzielle Erfahrungen möglich.
Was meinen Sie damit, wenn Sie schreiben: «Rilke ist einer der grossen Manieristen der Weltliteratur»?
Es gibt ja gräuliche Gedichte von ihm, vor allem aus den Anfängen. Die Sprache hat immer etwas Preziöses, Süssliches, Übersteigertes. Zum Beispiel war das Ü sein Lieblingsvokal: Gefühl, Gemüt, Frühling. Seine Ü-Räusche in «Sonette an Orpheus» sind fast schon zu aufdringlich. Aber da hatte er keine Hemmungen. Und manchmal klappt es ja auch. Im berühmten «Panther» funktioniert das Ä: «Als ob es tausend Stäbe gäbe/und hinter tausend Stäben keine Welt».
Wie sind Sie bei der Recherchearbeit zu dieser Biographie vorgegangen?
Eine Rilke-Biographie ist bezüglich der Hilfsmittel eine relativ leichte Angelegenheit. Es gibt diese Rilke-Chronik von Ingeborg Schnack, die streckenweise Tag für Tag das Leben von Rilke dokumentiert. Wo er war, was er gemacht hat, wen er getroffen hat. Dieses Werk war mein wichtigstes Hilfsmittel. Dann gibt es noch eine dreibändige Sammlung von Augenzeugenberichten über Rilke. De facto beschäftige ich mich seit 40 Jahren mit Rilkes Werk. Das Problem war eher die Auswahl.
Und wie haben Sie diese getroffen?
Mein Ziel war, eine Biographie für ein breites Publikum zu schreiben. Es durfte also nicht zu viel Werkanalyse sein. Und ich habe versucht, Fachvokabular zu vermeiden. Also nicht spezialistisch zu schreiben, sondern so, dass auch Leserinnen und Leser, die nichts mit Germanistik zu tun haben, das Buch verstehen. Das war nicht einfach, weil Rilke zum Teil schwer verständliche Gedichte geschrieben hat, zum Beispiel die berühmten Duineser Elegien. Es kommt aber nicht darauf an, sie im landläufigen Sinn zu verstehen, sondern man muss eine andere Art von Aufnahme dafür entwickeln.
Wie meinen Sie das?
Rilke ist ein Dichter, dessen Schreiben von Klang und Rhythmus lebt, die Bedeutung ist im Zweifelsfall sekundär. Dieser Autor hat eine Sprachmusikalität, die irrsinnig ist. Ein wunderbarer Widerspruch ist, dass er nach eigenen Angaben völlig unmusikalisch war.
Haben Sie nach 40 Jahren Rilke noch keine Überdosis?
(Lacht) Nein. Ehrlich gesagt habe ich jetzt eine heimliche Lust, einen kleinen Essay zu schreiben über seine Briefe an die Mutter. Das wird Ärger geben in der Besprechung des Buchs und in der Rilke-Welt. Es herrscht die Tendenz zu sagen, dass man die Mutter nicht dämonisieren darf. Aber Rilke schrieb an Freundinnen immer, was für ein entsetzliches Wesen diese Mutter war, die ihn in seiner Kindheit zerstört hat. Die Mutter hat ihn übrigens um sechs Jahre überlebt. Sie hat seine Briefe aufbewahrt, aber ihre Briefe an ihn zerstört. Dieser Mutter-Sohn-Beziehung möchte ich noch tiefer nachgehen, psychologisch und literarisch.
Manfred Koch stammt aus Stuttgart und lebt in Sent. Bis 2021 hat er an den Universitäten Giessen, Tübingen und Basel deutsche Literaturgeschichte unterrichtet. Zusammen mit der Schriftstellerin Angelika Overath führt er eine Schule für kreatives Schreiben in Sent.
Manfred Koch: Rilke - Dichter der Angst. Erschienen am 29. Januar 2025 im C.H. Beck-Verlag. 560 Seiten mit 30 Abbildungen. 978–3–406–82183–7.

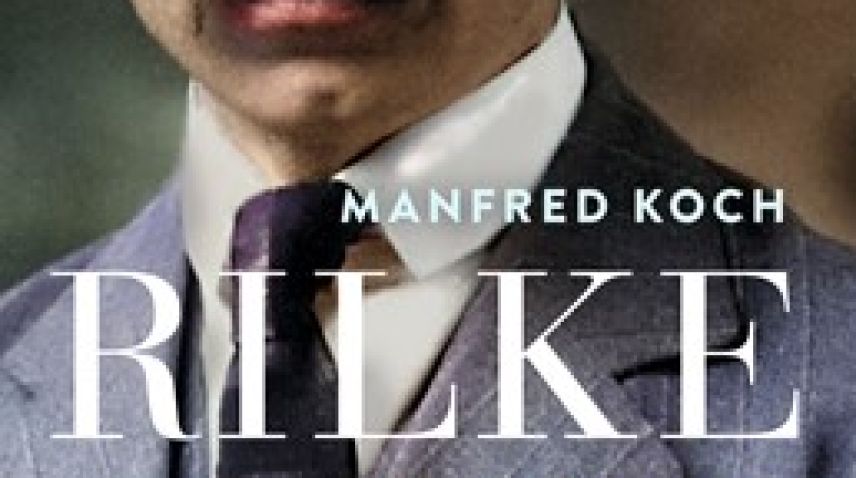


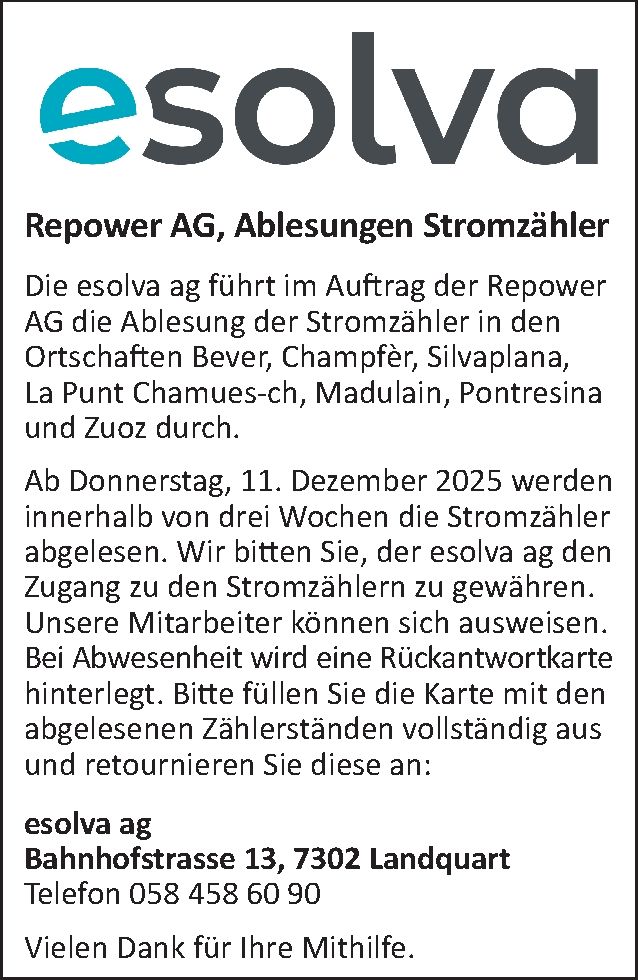














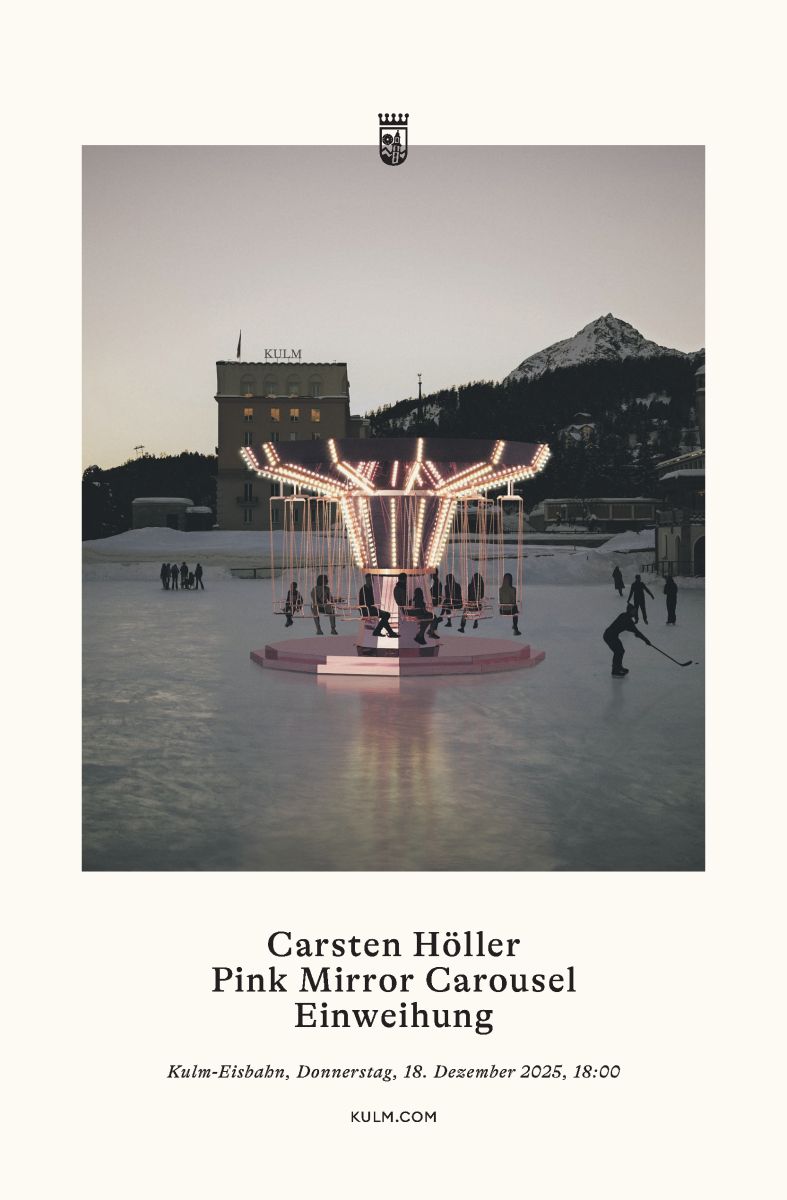

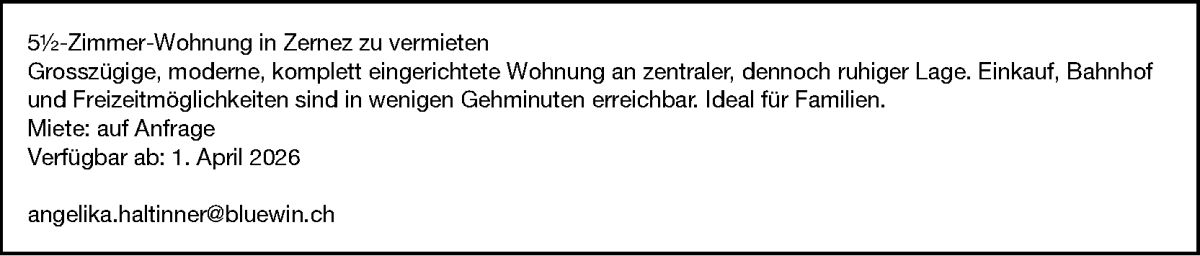



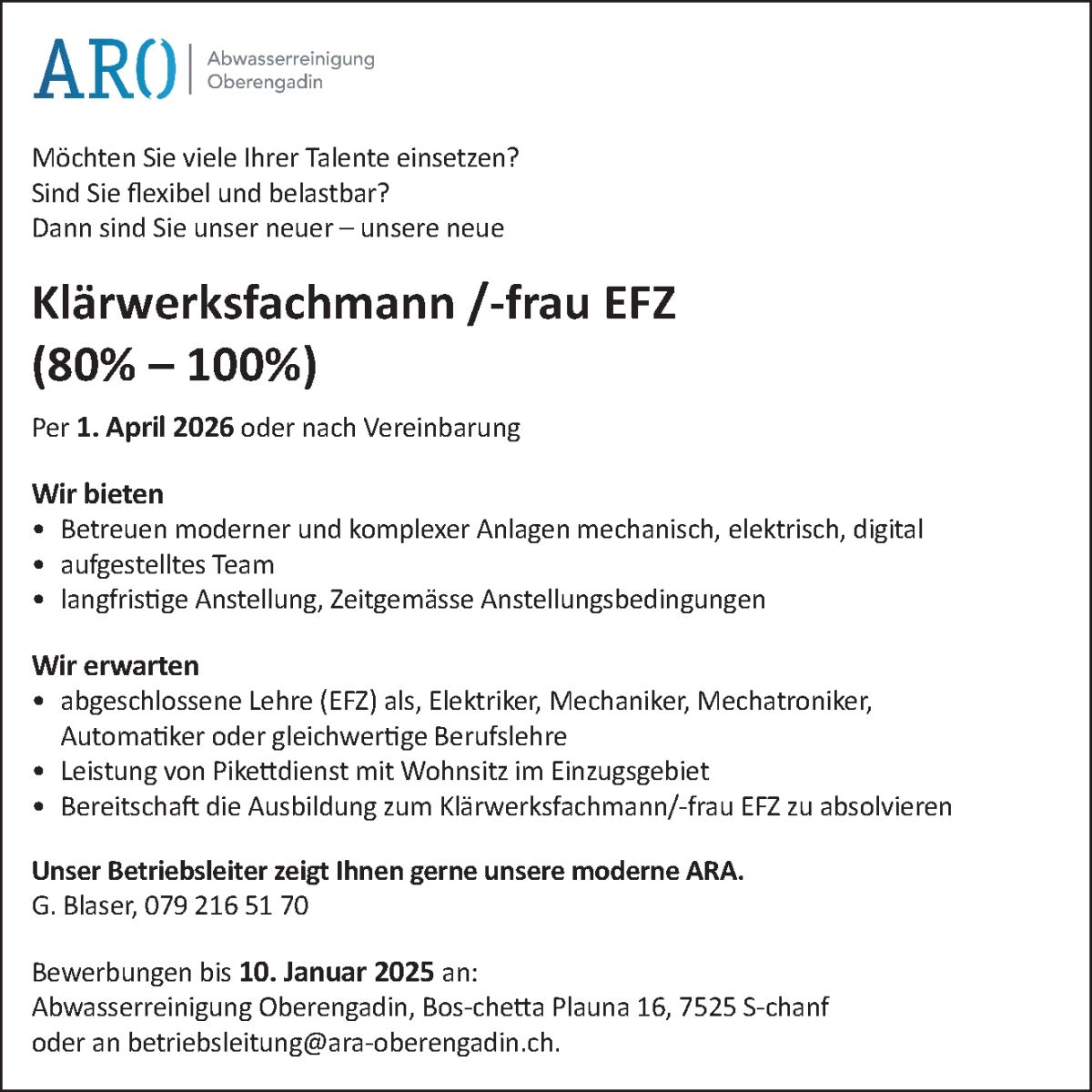







Diskutieren Sie mit
Login, um Kommentar zu schreiben